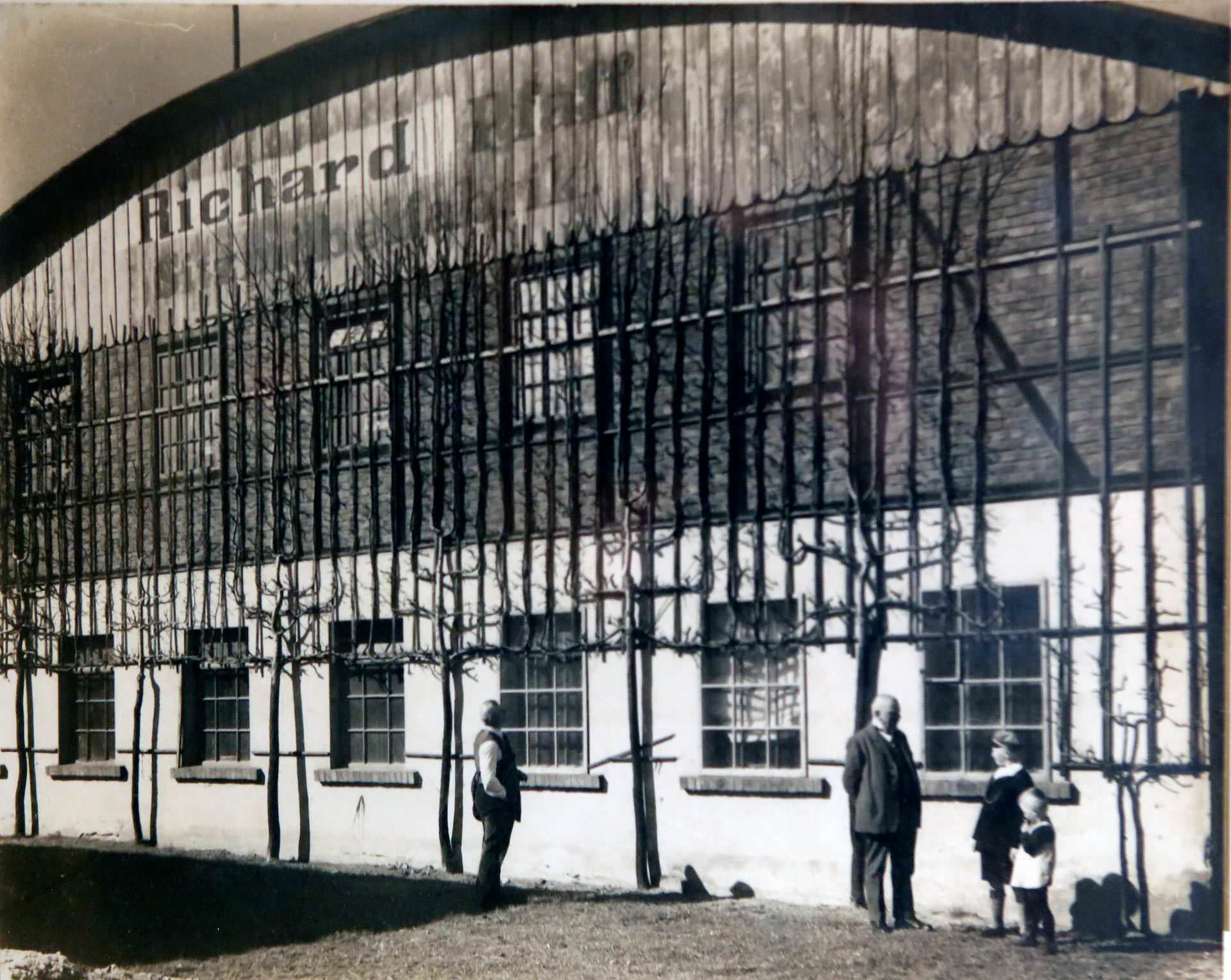Wer pendelt nach Sachsen hinein und aus dem Freistaat hinaus? Die Animation gibt Antworten.
„Halb sechs klingelt der Wecker“
Doreen Schneider pendelt mit dem Zug von Leipzig nach Berlin.
Entfernung: 194 Kilometer
Fahrzeit für eine Strecke: etwa zwei Stunden
Nächster Halt Berlin Südkreuz. Der ICE Richtung Leipzig ist voll an diesem Dienstagabend, fast jeder Platz von Reisenden besetzt. Doreen Schneider sitzt an einem Vierertisch, den Laptop im Rucksack griffbereit. Die Frau ihr gegenüber stopft sich Sushi aus einer Plastikbox in den Mund, der Mann auf dem Nebensitz telefoniert. Gedämpfte Unterhaltungen. Pendleralltag. Seit Januar verbringt Doreen Schneider zusätzlich zu ihrem Arbeitstag vier Stunden in der Bahn, jedenfalls dienstags, mittwochs und donnerstags. An diesen drei Tagen pendelt sie von Leipzig-Lindenau nach Berlin-Friedrichshain. Der Grund: Ihr Freund lebt in Leipzig, im Januar sind die beiden zusammen gezogen, vorher wohnte sie in Berlin, war Wochenendpendlerin.
Doreen Schneider ist 36 Jahre alt, eine kleine, schlanke Frau mit auffälliger dunkler Brille und leiser Stimme. Heute fühlt sie sich „leicht kaputt“, sagt sie. „Ich merke, dass ich zeitig aufgestanden bin.“ Halb sechs klingelt an Pendlertagen ihr Wecker, etwa eine Dreiviertelstunde später steigt sie in die Straßenbahn zum Bahnhof. 7.15 Uhr fährt der ICE am Leipziger Hauptbahnhof ab, am Hauptbahnhof in Berlin steigt Schneider eine Stunde später in die S-Bahn nach Friedrichshain, wo das Büro ihrer Firma ist.
Wer gilt als Pendler?
Pendler sind per Gesetz alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen, die nicht an ihrem Arbeitsort wohnen.
Und sie hat schon so einiges erlebt auf der Strecke. In Bielefeld erklärte der Zugführer „Jetzt halten wir gleich in der Stadt, die es gar nicht gibt.“ Nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo erlebte sie Schweigeminuten im Abteil. „Komplette Stille, das war schon sehr bewegend.“ Einmal saß sie im ICE von Berlin nach Hamburg, als der Zugführer das hintere Abteil während der Fahrt vom Vorderteil abkoppelte – wegen eines Defekts in den hinteren Wagen. „Wir wurden langsamer und blieben irgendwann stehen. Das war echt gruselig.“ Nach eineinhalb Stunden wurden die Fahrgäste über eine kleine Treppe evakuiert und konnten in einen nachfolgenden Zug umsteigen.
Nächster Halt: Wittenberg. Piep, Piep, die Türen schließen. Doreen Schneider bewegt ihre Beine. „Ich sitze extrem viel“, sagt sie, „entweder in der Bahn oder im Büro am Computer.“ Ihre Ballettlehrerin bescheinigte ihr „eine schlechte Haltung“.
Schneider klagt über Verspannungen und Rückenschmerzen. Als Ausgleich trainiert sie im Fitnessstudio, geht schwimmen und hat kürzlich mit Ballett angefangen. Sport macht sie eher montags und freitags, an den Home-Office-Tagen. Als klar war, dass sie künftig in Leipzig wohnen will, besprach Doreen Schneider ihre Pläne mit ihrem Vorgesetzen. Gemeinsam fanden sie eine Lösung. „Es war kein Kampf“, sagt Schneider, auch wenn ihr Situation eine Ausnahme im Unternehmen darstellt. Ihr Chef war einverstanden, dass sie an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeitet. „Mein Arbeitgeber weiß, was er an mir hat“, ist sie sich sicher.
Doreen Schneider beschreibt im Video, was Pendeln für sie bedeutet.
So fahren Pendler in Sachsen zum Arbeitsort
%
Bahn
%
Auto
In ihrem privaten Arbeitszimmer könne sie sich sogar besser konzentrieren als im Büro, weil sie weniger abgelenkt sei. Theoretisch könnte sie noch häufiger von zu Hause aus arbeiten. „Bei bestimmten Themen sollte man den Kollegen aber schon in die Augen gucken“, findet Schneider. An wichtigen Meetings nimmt sie lieber persönlich teil, auch wenn Videokonferenzen in der international ausgerichteten Firma normal seien. Viele Kollegen, die in den USA, Frankreich oder Norwegen arbeiten, werden per Skype zugeschaltet.
Noch zehn Minuten bis Leipzig, die Landschaft fliegt als Silhouette vorbei, es ist ruhiger geworden im Waggon.
Vielleicht, sagt Doreen Schneider, habe sie mit der Pendelei weniger Probleme, weil sie aus Berlin größere Entfernungen gewohnt sei. Zehn Jahre lang lebte die gebürtige Sächsin, die bei Eilenburg aufwuchs, in der Hauptstadt. Zuvor arbeitete sie einige Jahre in Hamburg und Stuttgart in einem Beruf, der noch mehr Flexibilität erforderte: als Flugbegleiterin. Zweieinhalb Jahre flog Schneider in die Türkei, nach Italien, Spanien und Georgien. „Da war ich echt nur mit dem Koffer unterwegs“, sagt sie. Selten saß sie abends wieder auf der eigenen Wohnzimmercouch. So aufregend sich viele ein Leben in der Luft vorstellen, am „Ende sind die Abläufe immer die gleichen, die Fragen und das Gemecker auch“, sagt Doreen Schneider und schmunzelt. Sie wollte sich weiterentwickeln, bildete sich weiter und landete schließlich in Berlin. Und nun der Weg zurück in die Heimat.
„Ich freue mich immer, wenn der Zug in Leipzig einrollt“, sagt die Pendlerin. Dass die Zugfahrten irgendwann ein Ende haben könnten, glaubt Schneider nicht. Sie habe bisher nicht aktiv gesucht, denkt aber nicht, dass es für sie einen passenden Job in Leipzig geben könnte. Wenn, dann könnte es eher passieren, dass es ihren Freund, der derzeit studiert, und sie nochmal in eine andere Stadt verschlägt. Aktuell aber ist die Messestadt der gemeinsame Lebensmittelpunkt.
Es ist kurz vor 19 Uhr. Der ICE ist in die Bahnhofshalle eingerollt. Doreen Schneider steigt aus und läuft über den Bahnsteig in Richtung Straßenbahn. Was sie heute noch vorhat? Abendessen, vielleicht mit ihren Eltern telefonieren – oder einfach vor dem Fernseher versacken.
„Pendeln ist sinnlose Zeit„
Björn Lindner fährt täglich von Schönebeck in Sachsen-Anhalt zur Arbeit ins Leipziger Porsche Werk.
Entfernung: 113 Kilometer
Fahrzeit für eine Strecke: etwa eine Stunde
Rechts schieben sich die Lkw-Kolonnen über die Fahrbahn, links überholen die Pkw-Fahrer, der Verkehr rollt auf der A 14 zwischen Magdeburg und Leipzig. Mittendrin sticht ein knalloranger Pick-Up aus der Blechmasse heraus. Es ist der nagelneue Nissan Navara von Björn Lindner. Von seinem Heimatort Schönebeck in Sachsen-Anhalt aus düst der 31-Jährige Montage-Arbeiter täglich ins Leipziger Porsche-Werk. Eine Stunde dauert die Fahrt zu seiner Arbeitsstätte.
Heute fängt die Spätschicht kurz vor 14 Uhr an. Schon kurz nach zwölf macht sich Lindner auf den Weg zur Arbeit, Er muss Zeit einplanen für die Parkplatzsuche, den Weg zu seiner Werkshalle und fürs Anziehen der Arbeitsklamotten. Die Fahrt empfindet er als „einfach nur nervig“. Seine tätowierten Arme umfassen das Lenkrad, steuern das Auto ruhig Richtung Autobahn. „Pendeln ist sinnlose Zeit.“ Aber was soll er machen? Seine Anstellung bei Porsche sei „ein sehr guter Job“, den er gern mache. Dafür nimmt er die Fahrt seit acht Jahren auf sich.
Björn Lindner erklärt, warum ihn das Pendeln stresst.
Wenn er zur Frühschicht fährt, die um sechs Uhr beginnt, muss er 4.30 Uhr das Haus verlassen. Das macht ihm allerdings nichts aus. „Ich bin Frühaufsteher.“ Es ist eher die Nachtschicht, die morgens um sechs endet, die seinen Biorhythmus stört. Für immer will er sich die Schichtarbeit nicht antun, sagt Lindner. Dabei hat sie auch Vorteile: „Ich hab dadurch Zeit, etwas zu erledigen, Ämter- oder Arztbesuche zum Beispiel.“
Welche Rolle spielt das Gehalt?
Wer mehr verdient, fährt häufiger mit dem Auto zur Arbeit. Bei einem geringen Einkommen nutzen die Beschäftigten eher Bus und Bahn, um zur Arbeit zu gelangen.
Was ihn am Pendeln am meisten nervt: „die aggressiven Autofahrer.“ In den vergangenen Jahren habe der Verkehr deutlich zugenommen. Lindner hat den Eindruck, dass alle viel gestresster sind. „So wie die Zeit gerade ist, dieses schnelle Leben, jeder hat Stress und Hektik – das spiegelt sich auf der Autobahn wider.“ Der Schönebecker ist ein ruhiger Fahrer. Er weiß, wenn er drängelt, kommt er auch nicht eher an. Und mit seinem neuen Pick-Up ist er lieber langsamer unterwegs, das Auto verbraucht neun Liter Diesel. Dabei halten sich die Benzinkosten mit etwa 200 Euro pro Person pro Monat noch in Grenzen – durch die Fahrgemeinschaft. Eine Monatskarte für die Bahn wäre mit etwa 280 Euro deutlich teurer, die Anbindung ans Porschewerk ist zudem schlecht. Mit Zug und Bus wäre Lindner deutlich länger unterwegs.
Dafür steht er mit seinem Pick-Up immer mal wieder im Stau. Einmal ereignete sich kurz vor ihm ein schwerer Unfall, es ging weder vor noch zurück. Er rief im Werk an, gab Bescheid, dass es später wird – und drehte letztlich wieder um. Bisher, sagt Lindner, sei er aber gut durch den Winter gekommen. Wenn es schneit, plant er noch mehr Zeit für die Fahrt ein. Eine Zeit lang war der Arbeitsweg des Mechanikers kürzer: Nachdem Linder seine Ausbildung bei Porsche in Stuttgart abgeschlossen und drei Jahre in dem Werk dort gearbeitet hatte, zog er 2008 nach Leipzig, wohnte auch in der Stadt. Doch dann zog es den gebürtigen Schönebecker wieder zurück, seine vierjährige Tochter, seine Familie und Freunde leben in der Stadt an der Elbe. „Ich find es hier schön“, sagt der Pendler. „Großstadt mag ich nicht. Zu viele Menschen, zuviel Trubel.“
In Schönebeck kennt er jeden, die Wege innerhalb der Stadt sind kurz. Der Automechaniker ist sich sicher, dass er auch im näheren Umkreis einen Job finden könnte, „aber der wäre sicher nicht so lukrativ“. Dass er durch das Pendeln seiner Gesundheit schadet, befürchtet Lindner nicht. Immerhin steht er während der Arbeitszeit die meiste Zeit, fährt zum Ausgleich Fahrrad, betreibt den Kampfsport Krav Maga. Kurz nach 13 Uhr. Björn Lindner ist jetzt auf dem Parkplatz des Werks angekommen und läuft Richtung Eingangstor Nord. Gleich wird er Autos zusammenbauen. Feierabend hat er gegen 22 Uhr Uhr. Dann geht es wieder zurück über die Autobahn – nach Schönebeck.
Einpendler nach Sachsen
Auspendler aus Sachsen
„Der Zeitdruck ist hoch“
Ronny Schmidt ist Berufskraftfahrer und steuert seinen Lkw von Leipzig bis in die Niederlande.
Entfernung: 700 Kilometer
Fahrzeit für eine Strecke: etwa 13 Stunden
Gemütlich zuckelt der quietschgrüne Lkw durch die engen Straßen Leipzigs, am riesigen Lenkrad des Kolosses sitzt Ronny Schmidt, 40 Jahre alt, ein kleiner Mann in Jeans und Pullover, mit silbernen Ringen im Ohr. „Schmidti“ – so steht es auf dem Schild hinter der Frontscheibe – fährt grundsätzlich nur in Socken. Er will sich schließlich wohlfühlen. „Ich lebe die ganze Woche hier drin.“ Es ist unerwartet kuschelig in der breiten Fahrerkabine: Die schwarzen Ledersitze sind weich, eine Duftkerze verbreitet frischen Geruch, das Radio dudelt im Hintergrund. Auf dem Armaturenbrett stehen Fotos von Schmidts Kindern – eine 13-jährige Tochter und ein zehnjähriger Sohn – daneben ein Tablet, das er als Navi nutzt, und ein Laptop – zum Fernsehschauen nach Feierabend.
Feierabend – den hat Ronny Schmidt dann, wenn andere gerade aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. Sein Arbeitstags bei der Firma IW-Transporte aus Leipzig-Engelsdorf beginnt an diesem Donnerstag 17 Uhr und endet am nächsten Morgen um sechs in den Niederlanden. Auf seiner Tour legt er etwa 700 Kilometer zurück: Von Leipzig fährt er nach Thüringen, lädt Ware ein, fährt dann nach Hessen, dort wird neu beladen, dann geht es weiter in den Ruhrpott und schließlich nach Holland.
4,5 Stunden darf er am Stück fahren, dann muss er eine 45-minütige Pause einlegen. Nach seiner Ankunft muss er elf Stunden lang pausieren, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Schmidt nutzt die Zeit unter anderem, um zu schlafen, in der Fahrerkabine Lkw gibt es zwei Klappbetten. „Ich schlafe hier mittlerweile besser als zu Hause“, sagt er. Am Abend geht es wieder retour: Von Holland über Hannover und Magdeburg nach Halle. So geht das die ganze Woche – von montags bis freitags. Der Lkw schaukelt gemütlich durch den Berufsverkehr, über eine schmale Auffahrt geht es auf die A 38, Ronny Schmidt reiht sich mit 80 Km/h ein in die Lkw-Kolonne. Von der Fahrerkabine aus wirken die Autos unten sehr klein.
Beladen wiegt der grüne Lkw inklusive Anhänger 40 Tonnen, transportiert werden Waren des täglichen Gebrauchs: Weinflaschen, Hundefutter, Matratzen, Kühlschränke, Fahrräder. Ronny Schmidt ist einer von 90 Fahrern, die das Logistikunternehmen beschäftigt. Die meisten fahren tagsüber, nur ein Teil in der Nacht. Ronny Schmidt gehört zu den Nachtschwärmern. „Ich bin mal eine zeitlang tagsüber gefahren, da hab ich graue Haare gekriegt.“ Nachts sei es ruhiger auf der Straße, selten steht er im Stau. Nur einmal, da saß er bei Würzburg im Winter mal sieben Stunden lang fest. Zum Glück hat sein Gefährt eine Standheizung.
Warum Ronny Schmidt so gern Lkw fährt, erklärt er im Video.
Der Lkw, sagt Ronny Schmidt, fahre fast selbstständig: Automatikschaltung, Tempomat und Abstandshalter erleichtern das Steuern, nur lenken muss er noch selbst. Die Technik hilft auch beim Wachbleiben: Würde sein Kopf im Sekundenschlaf auf das Lenkrad sacken, registriert das ein Sensor und gibt einen Signalton ab. Passiert sei ihm das noch nicht.
Im ersten Jahr fiel ihm der vertauschte Tag-Nacht-Rhythmus noch schwer, inzwischen „klappt das wunderbar“. Was Ronny Schmidt wirklich nervt, sind die Autofahrer. „Es gibt ganz schöne Idioten“, meckert er. „Einige denken, sie sind die einzigen, die es eilig haben“, beklagt er und hängt dann ein sächsisches „nor“ hinten an. Besonders das von vielen Autofahrern beklagte Elefantenrennen, bei dem ein Lkw einen anderen überholt, verteidigt er. „Es kann passieren, dass ich durchs Überholen eine Stunde Lenkzeit spare.“
Andere legen sich in die Badewanne, ich fahre Auto.
Eine andere Perspektive auf den Verkehr. Immerhin muss der Lkw-Fahrer seine Ware pünktlich ausliefern. „Der Zeitdruck ist sehr hoch. Die Zeiten werden immer enger gesetzt“, sagt Ronny Schmidt. Beeindrucken lasse er sich von dem Stress nicht. Wenn das Be- oder Entladen länger dauert, könne er ohnehin nichts machen. Zum Rasen lässt sich Schmidti nicht verleiten, beteuert er. Gerade mal drei, vier Mal sei er geblitzt worden in seinem Lkw-Leben. Seit sieben Jahren fährt der gebürtige Leipziger die großen Kolosse durch die Gegend, legt pro Jahr etwa 140.000 Kilometer auf der Straße zurück.
Ursprünglich war Schmidt Gerüstbauer, zehn Jahre lang arbeitete er auf dem Bau in der Schweiz und in den Niederlanden. Durch die schwere körperliche Arbeit sind sein Rücken und seine Gelenke geschädigt, sagt er. Das war ein Grund dafür, warum er umsattelte und sich als Berufskraftfahrer ausbilden ließ. „Das ist nichts anderes als Auto fahren, nur ein bisschen größer und breiter.“ Das Rangieren mit einem 18 Meter langen Hängerzug sei allerdings nicht ohne, gibt Schmidt zu. „Da hat man nicht viel Spielraum und muss lange üben, viele verzweifeln dran.“ Ein ganzes Jahr brauchte er, bis er das Rückwärtsfahren drauf hatte. Inzwischen beherrscht er diese Königsklasse, lädt Container mühelos auf und ab.
Schmidt wechselt jetzt auf die A9 Richtung Hermsdorfer Kreuz. Draußen ist es inzwischen dunkel geworden, die Scheinwerfer der überholenden Autos blitzen schemenhaft vorbei, während Schmidt seinen Lkw-Riesen ruhig über die Autobahn steuert.
Man kann sagen, dass der Kraftfahrer seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Schmidt fährt gern Auto, früher amerikanische Modelle, heute einen schnellen BMW. Das Gleiten über die Straße empfindet er als entspannend, sagt er. „Andere legen sich in die Badewanne, ich fahre Auto.“ Wenn Ronny Schmidt Freitagnacht von seiner Tour zurückkommt, setzt er sich in sein eigenes Auto und fährt nach Rostock, wo seine Familie lebt. Drei Stunden auf der Autobahn, er drückt dann häufig aufs Gas.
Seine Frau, die im Einzelhandel arbeitet, und seine beiden Kinder sieht der Lkw-Fahrer nur am Wochenende. Manchmal nimmt er die Kids mit zum Lkw-Waschen oder auf seine Tour, wenn sie Ferien haben. „Das finden sie natürlich ganz toll.“ Generell liebe er seine Freiheit, sagt Schmidt, aber natürlich fehle ihm seine Familie unter der Woche. „Das Privatleben leidet sehr darunter.“ Für Familie und Freunde bleibt bei einem Leben auf der Autobahn wenig Zeit. Genauso wie für seine Hobbys – Snowboardfahren im Fichtelgebirge, Hochseeangeln in Norwegen.
Dafür aber ist der Fahrerjob durchaus lukrativ. Mit Prämien und Spesen kommt Schmidt auf ein ordentliches Monatsgehalt, versichert er. Das ist auch der Grund, warum er sich bisher nicht in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Arbeit umgesehen hat. Dort seien die Gehälter schlechter.
Doch Schmidt spart auch, wo es möglich ist. Er meidet teure Raststätten, kauft zu Hause im Supermarkt ein und verstaut seine Packungen mit Käse und Salami in dem kleinen Kühlschrank in der Fahrerkabine. Er duscht bei seinen Logistik-Kunden statt auf Rasthöfen, wo dafür 2,50 Euro fällig wären. Schmidt sagt, er würde gern noch häufiger ins Ausland fahren, am besten jeden Tag ein neues Ziel ansteuern, fremde Gegenden kennenlernen. „Sonst hätte ich ja Busfahrer werden können, der fährt immer dieselbe Runde.“
Zwischenstopp auf einer Raststätte kurz vorm Hermsdorfer Kreuz. Ronny Schmidt kauft sich einen Kaffee, klettert dann flink wieder in seinen Lkw, hupt und steuert den Koloss weiter, immer Richtung Westen.
Video-Interviews und Texte: Gina Apitz, André Pitz Fotos und Videodreh: Dirk Knofe Schnitt: Leipzig Fernsehen, Trailer: Patrick Moye Grafik: Patrick Moye Konzept, Produktion: Gina Apitz Quellen: Statistisches Landesamt Sachsen, IHK Pendlerreport 2016, Statistischer Quartalsbericht der Stadt Leipzig 2016, Agentur für Arbeit